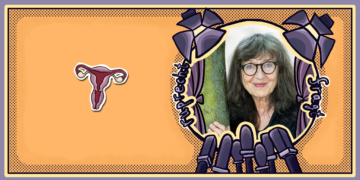In vielen Studiengängen sind mittlerweile die Hälfte der Studis Frauen. Professorinnen sind aber immer noch in der Unterzahl. Ein Erklärungsversuch
Heidelberg gilt mit über 200 Einrichtungen und 60.000 Angestellten im wissenschaftlichen Bereich zurecht als Topstandort. Auch Deutschland allgemein ist, was Forschung angeht, weltweit vorne mit dabei. Doch eine Schattenseite gibt es: Professor:innen sind meistens immer noch Männer.
Dabei sind laut den neuesten Zahlen der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz etwa die Hälfte der Menschen, die sich in Deutschland für ein Studium entscheiden, Frauen. Mit den Abschlüssen verhält es sich ähnlich, 45 Prozent der Doktorand:innen sind Frauen. Danach machen sich jedoch immer stärkere Unterschiede bemerkbar. Bis zur Habilitation sinkt der Frauenanteil auf etwa ein Drittel. Die Unterschiede lassen sich also nicht nur auf einzelne Hürden oder gar geringeres Interesse an Forschung zurückführen. Stattdessen summieren sich kleine Unterschiede über viele Karrierestufen bis hin zur Festanstellung im akademischen Bereich.
Für eine Wissenschaftlerin, mit der wir gesprochen haben, sei es „eher ein Marathon als ein Sprint“. Der Frauenanteil nimmt ab, je höher es auf der Karriereleiter geht. Dieses Phänomen wird als „Leaky Pipeline“ bezeichnet.
Diese Unausgeglichenheit hat diverse Gründe. Primär kann man Sexismus in Sachen Wissenschaft auf noch tief verwurzelte Rollenbilder in der Arbeitswelt zurückführen, so die Historikerin Jutta Dalhoff im Interview mit Nature. Laut einer großangelegten Recherche des Markt- forschungsunternehmens Ipsos ist dieser Faktor besonders in Zentraleuropa ausschlaggebend. Weltweit wurden bei dieser Studie in über 115 Ländern tausende Forschende kontaktiert. Dabei kam heraus, dass bei 72 Prozent der Forscherinnen der Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatwelt eine große Bürde darstellt. Bei den männlichen Wissenschaftlern trifft diese Aussage auf lediglich 55 Prozent zu.
Laut einer Studie der Wiener Tageszeitung der Standard lastet der sogenannte „mental load“ im Haushalt, also Planen, Koordinieren und Termine vereinbaren, noch immer überwiegend auf Frauen. Wenn man zuhause mit dem Großteil der Verantwortung konfrontiert wird, ist es schwer, einen Mittelweg zwischen Arbeit und Heim zu erreichen. Analog kann man die gleiche Argumentation benutzen, wenn es um die Frage der Auswirkung der Schwangerschaft und Familienplanung allgemein auf die Forschungsarbeit geht.
Ein weiterer erschwerender Aspekt ist persönlicher Natur. 52 Prozent der befragten Wissenschaftlerinnen gaben an, dass das fehlende Selbstvertrauen in die eigenen professionellen Fähigkeiten für sie eine Rolle spielt. Diese Aussage traf auf lediglich 31 Prozent der männlichen Befragten zu. Wenn man das dann abgleicht mit der Frage, inwiefern fehlender Respekt in der Arbeitswelt empfunden wird, scheint ein Zusammenhang klar. Hier gaben 30 Prozent der Frauen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, respektloses Verhalten als Spannungspunkt an. Bei den Männern waren es hier nur 17 Prozent.
Besonders stark machen sich die Unterschiede im akademischen Abschnitt nach dem Doktor bemerkbar. Auch im Interview erzählen manche Postdocs von vereinzeltem Alltagssexismus. „Zu 99 Prozent der Zeit habe ich mich gleichwertig behandelt gefühlt, aber in manchen Situationen sehr offensichtlich nicht“, berichtet uns beispielsweise Jennifer*. Es sind die kleinen und auf den ersten Blick unauffälligen Unterschiede, die sich mit der Zeit summieren.
Wir haben mit einer Dozentin der Universität Heidelberg und mit Postdocs gesprochen, um uns ein Bild über die aktuelle Lage zu machen. Dabei kam heraus, dass die Befragten in den Fällen, in denen es zu Benachteiligung oder Vorurteilen aufgrund des Geschlechts kam, viel Unterstützung aus dem professionellen und privaten Umfeld erhielten.
Bei den Arbeitsinfrastrukturen gibt es auch in Deutschland seit einigen Jahren einen positiven Trend. So kommt es, dass in vielen Laboren bestimmte Chemikalien in Teilen der Einrichtungen verboten sind, damit auch schwangere Frauen mit weniger Einschränkungen arbeiten können, wie auch die Postdocs Meike, Jennifer und Monika, mit denen wir gesprochen haben. Monika rät: „Ein Unterstützungsnetzwerk aus Mentor:innen und Kolleg:innen kann besonders in schwierigen Situationen wie ungleicher Behandlung in der Wissenschaft einen großen Unterschied machen.“
Meike findet, Laborarbeit sei oft unplanbar, „dafür sollte man sein Privatleben nicht hinten anstellen“. Jennifer sagt, „bleibt dabei, solange es euch Spaß macht“.
Von Bastian Mucha, Recherche unterstützt von Elena Lagodny
*Name von der Redaktion geändert
Bastian Mucha studiert irgendwas mit Naturwissenschaften (Molekulare Biotechnologie) und schreibt seit Sommersemester 2023 für den ruprecht. Neben der Leitung der Bildredaktion ist er vor allem für Illustrationen, Wissenschaft und Satire immer zu haben.
Josefine Nord studiert Politikwissenschaften und Literaturwissenschaft und schreibt seit dem Wintersemester 2021/22 für den ruprecht. Sie mag Drama, Meinung, investigative Recherchen und gesellschaftskritische Themen. Josefine Nord ist die Gute Laune-Beauftragte des ruprecht.