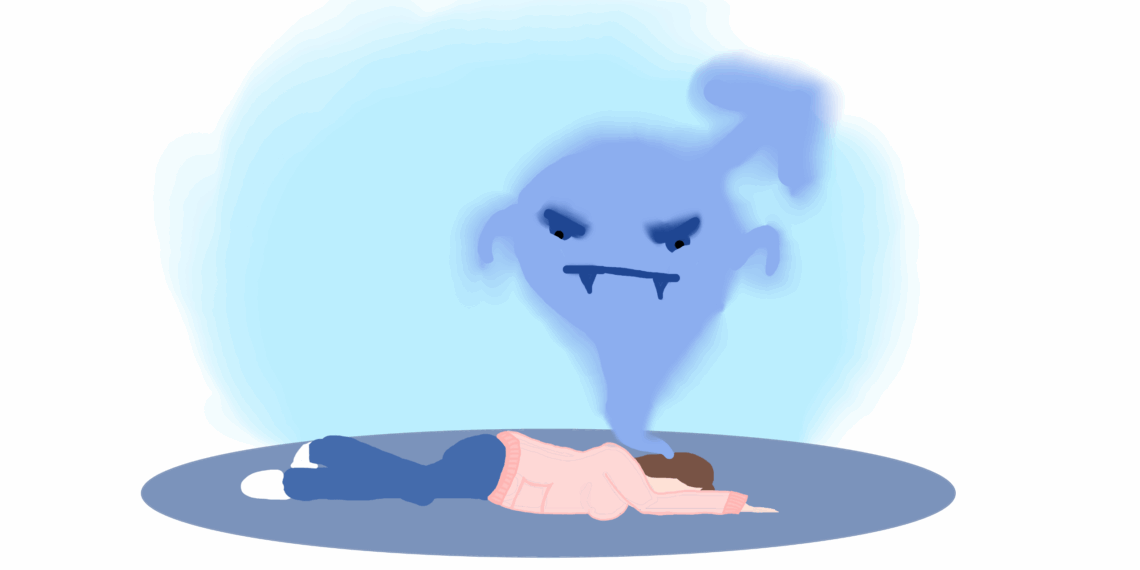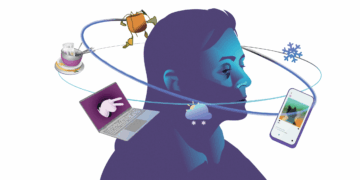Wie internalisierte Misogynie dafür sorgt, dass selbst Frauen andere Frauen scheiße finden.
„Pick me, choose me, love me“ fleht Meredith Grey in Grey’s Anatomy Derek Sheperd an, einen verheirateten Mann, sie anstatt seiner Ehefrau zu wählen. Sie ist die Mutter der Pick Me Girls, einem Begriff, mit dem in den letzten Jahren Frauen und Mädchen bezeichnet werden, die sich verstellen, um Männern zu gefallen und das eigene Geschlecht grundsätzlich abwerten.
Misogynie, also der strukturelle und kulturelle Hass auf Frauen, prägt seit Jahrhunderten unsere Gesellschaft und damit auch die Medienlandschaft. Sie zeigt sich nicht als zentrales Thema von Film und Druck, sondern wirkt unterschwellig, schreibt den Frauen passive Rollen zu: Musen, die nur im Kontext ihres Körpers existieren, tote Ehefrauen, die dem Hauptcharakter ein Motiv für Rache bieten oder Nebenfiguren, die der männlichen Selbstverwirklichung dienen.
Noch subtiler wirkt die internalisierte Misogynie. Dabei handelt es sich um die unbewusste Verinnerlichung von frauenfeindlichen Denkmustern – auch von Frauen selbst. Mit dem Ziel sich gegenüber anderen Frauen abzugrenzen werden gesellschaftlich geprägte Stereotype über Weiblichkeit übernommen und „typisch weibliche“ Interessen abgelehnt.
Das beeinflusst auch, wie Frauen in Medien geschrieben und dargestellt werden – nicht jede Figur, die aus der Feder einer Frau stammt, ist frei von Stereotypen. So entstehen Charaktere wie Bella Swan aus „Twilight“ oder Kat Stratford aus „10 Things I Hate About You“: Mädchen, die sich dadurch definieren, „nicht wie die anderen“ zu sein, die Pink hassen und Fast Food essen, die das Make-Up und die Mode anderer belächeln.
Bella Swans Andersartigkeit zieht sich durch die Handlung von „Twilight“, bildet sogar die Grundlage der Geschichte und ihrer Konflikte. Nur sie schafft es, die Auf- merksamkeit des mysteriösen Vampirs Edward auf sich zu ziehen. Warum? Weil sie die Einzige ist, deren Gedanken er nicht lesen kann. Von Anfang an dreht sich ihr Leben fast ausschließlich um Männer und ihre Persönlichkeit bleibt so blass wie ihre Haut.
Kat Stratford, die als überzeugte Feministin dargestellt wird, schaut gleichzeitig auf ihre Schwester herab, die sich feminin kleidet und für Jungs interessiert. Das von zwei Frauen geschriebene Drehbuch charakterisiert Kat als die schlauere und nüchterne Schwester, weil sie nicht „boy crazy“ ist. Der Höhepunkt der Handlung spielt dennoch auf dem Abschlussball, zu dem sie entgegen ihrer vorherigen Überzeugung geht, weil ein Mann sie nur hartnäckig genug eingeladen hat.
Wie viele weibliche Charaktere bewegt sich Kat in einem Paradox, das tief in der internalisierten Misogynie verwurzelt ist. Selbst Figuren, die sich von klassischen Mädchenbildern abgrenzen, halten dennoch die Balance zum Idealbild einer femininen Frau. So verabscheut Kat zum Beispiel Mode, dennoch ist ihre Schauspielerin eine normschöne Frau, ihre Figur kleidet sich ausschließlich vorteilhaft. Ihre Rebellion bleibt stilistisch kontrolliert – nie „zu viel“, nie wirklich unbequem.
Solche Narrative beeinflussen, wie Mädchen sich selbst und andere Frauen betrachten. Die zugrundeliegenden Denkmuster verschwinden nicht von selbst, sie wachsen mit uns auf und schleichen sich in unseren Blick ein und reproduzieren sich in alltäglichen Urteilen über andere Frauen und Mädchen.
Man kann gegen die Stereotypen über Frauen nicht gewinnen, indem man sich von allem Weiblichen abgrenzt und darauf herabschaut. Nur ein bewusster Umgang mit unserem Blick auf die Frauen aus Realität und Fiktion kann helfen, diese veralteten, frauenfeindlichen Denkmuster sichtbar zu machen und endlich aus der Welt zu schaffen.
Kommentar von Hanna Batz und Lajla Hujdur